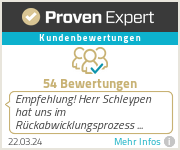Sanierter Altbau und Gewährleistung
Beim Erwerb von Altbauten ist Werkvertragsrecht anwendbar, wenn der Erwerb des Grundstücks mit einer Herstellungsverpflichtung verbunden ist. Übernimmt der Verkäufer vertraglich Bauleistungen, die insgesamt nach Umfang und Bedeutung Neubauarbeiten vergleichbar sind, haftet er nicht nur für die ausgeführten Umbauarbeiten, sondern auch für die Altbausubstanz nach den Gewährleistungsregeln des Werkvertrages (vgl. BGH, Urteil vom 16.12.2004, VII ZR 257/03).
Ohne Bedeutung ist es dabei, ob die Parteien den Vertrag als Kaufvertrag und sich selber als Käufer und Verkäufer bezeichnet haben (vgl. BGH, Urteil vom 16.12.2004, VII ZR 257/03).
Dass die von dem Verkäufer versprochenen Sanierungsarbeiten zum Zeitpunkt des Abschlusses des Veräußerungsvertrages bereits fertig gestellt waren, steht der Anwendung von Werkvertragsrecht ebenfalls nicht entgegen. Auf den Erwerb einer neu errichteten Wohnung ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH auch dann Werkvertragsrecht anzuwenden, wenn die Bauleistungen bei Vertragsschluss bereits abgeschlossen sind. Die hierfür maßgeblichen Gründe gelten in gleichem Maße auch für die Veräußerung eines sanierten Altbaus. Sowohl in dem einen, wie in dem anderen Fall, ist allein entscheidend, ob sich aus Inhalt, Zweck und wirtschaftlicher Bedeutung des Vertrages sowie aus der Interessenlage der Parteien die Verpflichtung des Veräußerers zur mangelfreien Erstellung des Bauwerks ergibt. Ist dies zu bejahen, knüpft daran die Sachmängelgewährleistung nach Werkvertragsrecht an (vgl. BGH, Urteil vom 16.12.2004, VII ZR 257/03).
Die Verpflichtung zu Maßnahmen, die insgesamt einer Neuherstellung gleichkommen, muss nichtausdrücklich übernommen worden sein. Sie kann sich aus dem Zusammenhang der einzelnen Vertragsbestimmungen, aus ihrem Zweck und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, aus der Interessenlage der Parteien sowie aus den gesamten Umständen herleiten, die zum Vertragsschluss geführt haben. Dazu gehören auch solche Erklärungen, die der Veräußerer bei der Beschreibung des Objektes abgegeben hat und zwar unabhängig davon, ob sie schriftlich oder mündlich erfolgten (vgl. BGH, Urteil vom 06.10.2005, VII ZR 117/04).
Wenn die Vertragsparteien dann dennoch den Vertrag als „Kaufvertrag“ und nicht als „Werkvertrag“ bezeichnen und in diesem einen Gewährleistungsausschluss aufnehmen, ist dieser unwirksam, wenn es sich dabei um allgemeine Geschäftsbedingungen handelt. Sollte der Gewährleistungsausschluss individualvertraglich ausgehandelt worden sein, ist auch dieser gemäß § 242 BGB unwirksam, wenn es sich dabei um einen formelhaften Ausschluss der Gewährleistung für Sachmängel beim Erwerb neu errichteter oder so zu behandelnder Eigentumswohnungen und Häuser handelt und die Freizeichnung nicht mit dem Erwerber unter ausführlicher Belehrung über die einschneidenden Rechtsfolgen erörtert worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 16.12.2004, VII ZR 257/03).